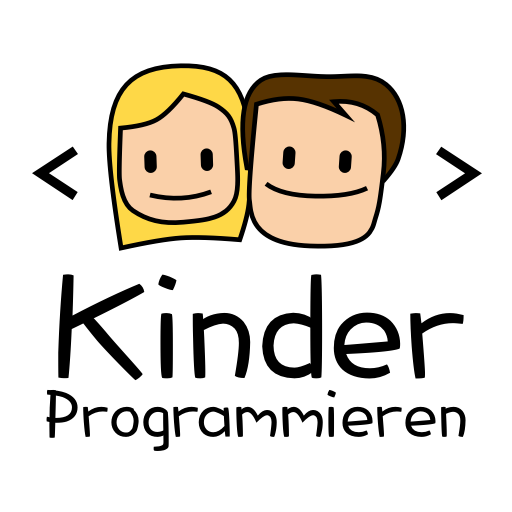Makeblock Codey Rocky – Programmierbares Spielzeug für Grundschulkinder
Makeblock Codey Rocky, einfach erklärt. Die Welt von heute wird zunehmend von digitalen Technologien geprägt. Daher gewinnt es an Bedeutung, Kinder frühzeitig mit den Grundlagen des Programmierens vertraut zu machen. Programmierbares Spielzeug bietet dafür einen idealen Einstieg: Es ermöglicht Kindern, auf spielerische Weise zu erleben, wie eigene Befehle und Ideen zu sichtbaren Ergebnissen führen. Anstatt trockener Theorie steht der Spaß am Experimentieren im Vordergrund – abstrakte Konzepte werden greifbar, wenn ein Roboter sich auf Knopfdruck bewegt oder ein Lämpchen in verschiedenen Farben leuchtet.
Bereits im Grundschulalter gibt es vielfältige Möglichkeiten, Programmieren zu lernen, ohne dass dafür komplizierter Textcode geschrieben werden muss. Viele moderne Lernspielzeuge setzen auf grafische Blockprogrammierung: Bunte virtuelle Bausteine, die wie Puzzleteile zusammengesetzt werden, repräsentieren verschiedene Befehle. So können Kinder auch ohne fortgeschrittene Lese- oder Schreibkenntnisse einfache Abläufe erstellen. Eltern müssen selbst keine Programmierprofis sein – das intuitive Prinzip dieser Spielzeuge erleichtert den gemeinsamen Einstieg und sorgt dafür, dass Erwachsene ebenso wie Kinder Freude am Entdecken haben können.
Ein aktuelles Highlight in diesem Bereich ist der programmierbare Roboter Makeblock Codey Rocky. Dieser kleine, niedliche Lernroboter wurde speziell für Kinder im Grundschulalter entwickelt und kombiniert Unterhaltung mit Lerneffekt. Im Folgenden schauen wir uns genauer an, was Codey Rocky auszeichnet, wie er funktioniert und welchen pädagogischen Nutzen er für Grundschulkinder bietet.
Makeblock Codey Rocky – Hardware, Design und Ausstattung
Codey Rocky besteht aus zwei Teilen: dem Codey und dem Rocky. Codey ist die abnehmbare Steuerungseinheit – praktisch das „Gehirn“ des Roboters. Er enthält ein LED-Display als Gesicht, diverse Knöpfe und einen Drehregler sowie die meisten Sensoren. Rocky ist der fahrbare Untersatz mit zwei angetriebenen Rädern (über Raupenketten wie bei einem kleinen Panzer), der dem Roboter Mobilität verleiht. Die beiden Teile lassen sich unkompliziert verbinden: Setzt man Codey auf Rocky, entsteht ein voll funktionsfähiger Mini-Roboter, der rollen und interagieren kann. Nimmt man Codey ab, kann dieser auch eigenständig als Handgerät genutzt und programmiert werden – zum Beispiel um nur das Display oder die Sensoren zu verwenden.


Das Design von Codey Rocky ist kindgerecht und robust. Der Roboter kommt fertig montiert und sofort einsatzbereit aus der Verpackung – kein komplizierter Aufbau ist nötig, was besonders jungen Tüftlern und ungeduldigen Entdeckern entgegenkommt. Sein Gehäuse besteht aus solidem Kunststoff mit abgerundeten Ecken, sodass keine scharfen Kanten vorhanden sind. Die Farbkombination (häufig Weiß mit schwarzen Akzenten) und das freundliche LED-Gesicht verleihen ihm ein sympathisches, ansprechendes Äußeres. Durch die strapazierfähige Konstruktion verkraftet Codey Rocky auch den einen oder anderen Stoß oder Fall aus geringer Höhe – er ist schließlich dafür gemacht, im Kinderzimmeralltag zu bestehen.
Zum Lieferumfang des Sets gehören neben dem Roboter selbst auch einige nützliche Extras. Ein Micro-USB-Kabel liegt bei, mit dem der integrierte Akku aufgeladen (und bei Bedarf eine Verbindung zum PC hergestellt) werden kann. Außerdem enthalten sind mehrere farbige Karten, die für erste Programmierübungen mit dem Farbsensor gedacht sind (etwa um Linien zu verfolgen oder Farben zu erkennen). Ein liebevolles Detail ist der beiliegende Namensaufkleber: Kinder können dem Roboter einen eigenen Namen geben und diesen auf Codey Rocky kleben – so wird das Gerät gleich zu ihrem persönlichen Freund. Auch ein kleines Trageband (Lanyard) ist dabei, mit dem man die abnehmbare Codey-Einheit um den Hals hängen oder wie einen Anhänger transportieren kann. Diese umfangreiche Ausstattung zeigt, dass an vieles gedacht wurde, um den Einstieg so leicht und individuell wie möglich zu gestalten.
Eine besondere Stärke von Codey Rocky liegt in seiner Erweiterbarkeit durch LEGO. Am Gehäuse befinden sich mehrere Aufnahmepunkte, die mit gängigen LEGO-Technic-Bausteinen kompatibel sind. Das bedeutet, Kinder können ihren Codey Rocky nach Belieben umbauen und erweitern: Beispielsweise lassen sich zusätzliche Deko-Elemente anbringen, eigene Figuren oder Aufsätze konstruieren oder sogar funktionale Ergänzungen bauen. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt – ob man dem Roboter ein lustiges Hütchen aus Bausteinen bastelt oder eine Halterung konstruiert, um einen Stift einzuklemmen und Zeichnungen fahren zu lassen. Dieses offene Konzept fördert kreatives Bauen und sorgt dafür, dass der Roboter nicht nur als Fertigprodukt wahrgenommen wird, sondern auch als Teil der eigenen Bau- und Spielwelt.
Nicht zuletzt macht das LED-Gesicht auf Codey Rocky ihn zu etwas Besonderem. Hinter einer dunklen Frontscheibe verbirgt sich eine Matrix aus kleinen LEDs, die verschiedene Muster und Mimiken darstellen kann. So kann Codey Rocky z.B. fröhlich blinzeln, überrascht schauen oder auch Symbole wie Herzen, Zahlen und Buchstaben anzeigen. Kinder schließen den Roboter gerade wegen dieser „Emotionen“ schnell ins Herz – er wirkt fast lebendig und kann je nach Programmierung gute Laune verbreiten oder niedlich schmollen. Neben dem Display findet man auf der Oberseite von Codey auch mehrere Tasten (teils mit A, B, C beschriftet) sowie einen Drehregler. Diese Bedienelemente sind nicht nur für die direkte Nutzung (z.B. Ein/Aus, Lautstärke) praktisch, sondern lassen sich auch in eigenen Programmen abfragen. So kann ein Kind z.B. programmieren, dass beim Drücken einer bestimmten Taste der Roboter ein Lied abspielt oder dass der Drehknopf die Fahrgeschwindigkeit steuert. All diese durchdachten Hardware-Details machen Codey Rocky zu einem vielseitigen Spielgefährten, der in Sachen Ausstattung weit mehr bietet als ein simples ferngesteuertes Auto.

Technische Funktionsweise: Sensoren, Motorik und Konnektivität
Unter der Haube von Codey Rocky steckt beeindruckende Technik, die aber so verpackt ist, dass Kinder sie intuitiv nutzen können. Der Roboter verfügt über mehr als 10 elektronische Module, die ihm Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeiten verleihen. Hier ein Überblick über die wichtigsten Sensoren und Aktoren von Codey Rocky:
Sensoren (Eingaben): Codey Rocky ist mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, durch die er seine Umgebung wahrnehmen kann:
- Farbsensor / Liniensensor: Im fahrbaren Untersatz (Rocky) befindet sich ein Sensor, der Farben und Kontraste erkennt. Damit kann Codey Rocky z.B. einer aufgezeichneten Linie auf dem Boden folgen oder farbige Markierungen unterscheiden. Malt man etwa einen schwarzen Strich auf Papier, so kann der Roboter diesem Weg automatisch nachgehen. Auch die beiliegenden Farbkarten lassen sich nutzen: Codey Rocky erkennt die Farbe jeder Karte und kann entsprechend darauf reagieren.
- Infrarot-Abstandssensor: An der Vorderseite besitzt der Roboter einen Infrarot-Sensor, der Distanzen misst. Ähnlich wie ein kleines elektronisches Auge erkennt Codey Rocky damit Hindernisse oder Objekte vor sich. So kann er programmiert werden, vor einer Wand rechtzeitig anzuhalten oder einem vorauslaufenden Objekt in einem bestimmten Abstand zu folgen. Diese Fähigkeit wird für Hindernisvermeidung und Abstandssteuerung genutzt.
- Lichtsensor: In der Codey-Einheit ist ein Sensor verbaut, der die Helligkeit der Umgebung misst. Damit „bemerkt“ der Roboter, ob es hell oder dunkel ist. In Programmen kann dieser Wert genutzt werden, um z.B. bei Dunkelheit automatisch ein Licht einzuschalten oder umgekehrt bei grellem Licht eine andere Aktion auszulösen. So lernen Kinder spielerisch, auf Umgebungsbedingungen zu reagieren.
- Geräuschsensor (Mikrofon): Ebenfalls in der Codey-Einheit befindet sich ein kleiner Mikrofon-Sensor, der Umgebungsgeräusche wahrnimmt. Er kann beispielsweise einen lauten Knall, Händeklatschen oder einen Ruf registrieren. Dies ermöglicht lustige Sound-Interaktionen: Man kann den Roboter etwa darauf programmieren, bei einem Klatschgeräusch eine Bewegung oder einen Lichteffekt auszuführen. Dadurch verstehen Kinder, wie akustische Signale als Auslöser dienen können.
- Gyroskop und Beschleunigungssensor: Codey Rocky verfügt über einen integrierten 6-Achsen-Lagesensor (Kombination aus Gyroskop und Accelerometer). Dieser Sensor merkt, wie der Roboter bewegt wird – ob man ihn kippt, schüttelt oder dreht. Solche Bewegungen können in Programmen als Auslöser dienen. Ein Beispiel: „Wenn Codey Rocky nach links geneigt wird, dann zeige ein schwindliges Gesicht auf dem Display.“ Damit können Kinder auch die Dimension der körperlichen Bewegung in ihre Programme einbeziehen, z.B. um ein Schüttel- oder Neigespiel zu programmieren.
- Infrarot-Transmitter/Empfänger: Neben dem Abstandssensor zum Messen kann Codey Rocky auch gezielt Infrarot-Signale aussenden und empfangen. Dies erlaubt es, mehrere Codey-Rocky-Roboter miteinander „kommunizieren“ zu lassen (sie könnten sich z.B. Signale schicken oder in einem Spiel gegeneinander antreten). Sogar die Steuerung von haushaltsüblichen IR-Geräten (wie dem Fernseher) ist denkbar, indem man Codey Rocky entsprechende Codes senden lässt. Dieses fortgeschrittene Feature zeigt, wie vielseitig die Sensorik ist – es kann bei Bedarf kreativ genutzt werden, steht aber Anfängern nicht im Weg.
Aktoren (Ausgaben): Auf sensorische Eingaben kann Codey Rocky vielfältig reagieren, denn er besitzt etliche Ausgabemöglichkeiten:
- Zweirad-Antrieb: Im Rocky-Untersatz sind zwei kleine Motoren verbaut, die die Räder bzw. Raupenketten antreiben. Durch gezieltes Ansteuern dieser Motoren kann Codey Rocky vorwärts und rückwärts fahren sowie auf der Stelle drehen (wenn ein Rad vorwärts und das andere rückwärts läuft). Er ist flink genug, um einem gezeichneten Parcours zu folgen, aber auch präzise steuerbar, um z.B. langsam an ein Hindernis heranzutasten. Geschwindigkeit und Drehrichtung sind programmierbar, sodass auch choreografierte Bewegungsabläufe – etwa in Form eines kurzen „Tanzes“ – möglich sind.
- LED-Matrix-Display: Das LED-Display auf der Vorderseite von Codey fungiert als Gesicht und zugleich als Bildschirm. Es besteht aus einer Matrix kleiner Leuchtdioden, mit denen diverse Muster dargestellt werden können. In Programmen kann man dieses Display frei ansteuern: Es lassen sich vorgefertigte Grafiken (lachendes Gesicht, trauriges Gesicht, Herz, etc.) anzeigen oder eigene Pixelbilder gestalten. Auch Lauftexte oder kleine Animationen sind möglich. Dies ist nicht nur ein Spaßfaktor, sondern vermittelt auch Grundlagen der visuellen Darstellung in der Programmierung.
- RGB-LED-Indikator: Zusätzlich zur Matrix besitzt Codey Rocky mindestens eine weitere LED, die in allen Farben leuchten kann (RGB = Rot, Grün, Blau Mischung). Diese dient als Statuslicht oder Effektbeleuchtung. Ein Kind könnte z.B. programmieren, dass diese LED blau blinkt, wenn der Roboter gerade „nachdenkt“, oder rot leuchtet, wenn ein bestimmter Sensorwert überschritten wird. So lernt man, Zustände visuell zu codieren – ähnlich einer Ampelanzeige für den Roboter.
- Lautsprecher: In der Codey-Einheit ist ein kleiner Lautsprecher integriert. Über diesen kann der Roboter Töne und Melodien abspielen – von einfachen Pieptönen bis zu kurzen Musiksequenzen. Es sind ein paar Sounds vorinstalliert (z.B. ein fröhliches Jingle oder Effektsounds), und man kann auch eigene Tonfolgen erstellen. Dadurch wird Codey Rocky akustisch lebendig. Kinder lieben es zum Beispiel, dem Roboter eine Stimme zu geben oder ihn ein selbst komponiertes Lied spielen zu lassen.
- Programmierbare Tasten und Regler: Wie erwähnt, hat Codey mehrere eingebaute Knöpfe (A, B, C) und einen Drehknopf. Diese dienen nicht nur zur Bedienung, sondern können auch im Code abgefragt werden. So kann man Programme schreiben, die erst beim Drücken einer Taste starten oder je nach gedrückter Taste unterschiedliche Abläufe zeigen. Der Drehregler lässt sich etwa verwenden, um eine Variable zu steuern – zum Beispiel die Lautstärke des Lautsprechers oder die Farbe der RGB-LED dynamisch zu verändern. Auf diese Weise lernen Kinder, eigene Bedienelemente für ihren Roboter zu gestalten und Interaktivität einzubauen.
Konnektivität: Damit all diese Funktionen genutzt werden können, wird Codey Rocky mit einer digitalen Programmierumgebung gekoppelt. Die Verbindung gelingt auf zwei Wegen – je nach Gerät: Entweder drahtlos per Bluetooth (typischerweise bei Nutzung mit einem Tablet oder Smartphone) oder verkabelt per USB (vor allem bei Nutzung mit einem PC/Laptop). Die Kopplung ist einfach gehalten: Man schaltet den Roboter ein, öffnet die App oder Software auf dem Gerät und wählt „Codey Rocky verbinden“. Ein separates Bluetooth-Dongle ist nicht nötig (bei älteren PCs ohne Bluetooth kann ein einfacher USB-Adapter helfen).
Darüber hinaus verfügt Codey Rocky über ein WLAN-Modul. Dieses wird nicht zur Verbindung mit dem Steuergerät genutzt, sondern ermöglicht es dem Roboter, selbstständig ins Internet zu gehen. In fortgeschrittenen Projekten kann Codey Rocky z.B. über WLAN das aktuelle Wetter aus dem Internet abrufen und auf seinem Display anzeigen oder mithilfe eines Dienstes wie IFTTT bestimmte Aktionen im Smart Home auslösen. Diese IoT-Fähigkeit (Internet of Things) eröffnet spannende Möglichkeiten, ist aber völlig optional – für die Grundfunktionen ist keine Internetverbindung erforderlich. Insgesamt ist Codey Rocky technisch so ausgestattet, dass er als Bindeglied zwischen der realen und der digitalen Welt fungiert: Er kann seine Umgebung wahrnehmen, Entscheidungen im Programm treffen und daraufhin Handlungen ausführen. Genau dieses Zusammenspiel macht den Reiz des Programmierens mit ihm aus.


Pädagogischer Nutzen: Welche Kompetenzen fördert Codey Rocky?
Neben dem reinen Spielspaß hat Codey Rocky einen hohen pädagogischen Wert. Bei der Beschäftigung mit dem Roboter erwerben Kinder ganz nebenbei eine Reihe von Fähigkeiten und Kompetenzen, die in der heutigen Zeit immer wichtiger werden. Hier einige der wichtigsten Förderaspekte im Überblick:
- Logisches und algorithmisches Denken: Um Codey Rocky Aufgaben zu geben, müssen Kinder Abläufe in sinnvolle Schritte zerlegen – genau das ist Kern des algorithmischen Denkens. Sie lernen, Ereignisse in eine logische Reihenfolge zu bringen („erst A, dann B“) und einfache Wenn-Dann-Logiken zu begreifen. Das schult ihr Verständnis für Ursache und Wirkung und hilft ihnen später in Mathematik und anderen Problemlöseprozessen.
- Problemlösungsfähigkeit: Beim Programmieren treten fast immer kleine Fehler oder unerwartete Ergebnisse auf. Kinder lernen mit Codey Rocky, solche Probleme systematisch zu lösen. Sie erleben, dass man bei einem Fehler im Programm den Ansatz ändern oder schrittweise testen muss, bis es klappt. Diese Hartnäckigkeit und Strategieentwicklung („Wo könnte der Fehler liegen? Wie kann ich es anders machen?“) sind wertvolle Kompetenzen – auch abseits der Computerwelt.
- Kreativität und Fantasie: Programmieren mit einem so vielseitigen Tool wie Codey Rocky fördert die kreative Ader der Kinder. Sie können eigene Geschichten und Spielszenarien erfinden – sei es ein Roboterhund, der Kunststücke vorführt, oder ein „Polizeiauto“, das mit Sirenensound einem Dieb (einer Spielzeugfigur) hinterherjagt. Durch die Möglichkeit, optisch (Display, LEDs) und akustisch (Sounds) kreativ zu werden, verbinden sich künstlerische und technische Elemente. Es gibt kein Richtig oder Falsch – die Kinder gestalten Projekte nach ihren eigenen Ideen und lernen dadurch auch, stolz auf selbsterschaffene Lösungen zu sein.
- Medienkompetenz und technisches Verständnis: Indem Kinder einen Roboter selbst steuern und programmieren, gewinnen sie Einblicke in die Funktionsweise moderner Technik. Begriffe wie Sensor, Algorithmus oder Daten werden erlebbar und begreifbar gemacht. Dies trägt zur Medienkompetenz bei – Kinder verstehen besser, wie Computer „denken“ und wie digitale Geräte gesteuert werden. Statt Technik nur passiv zu konsumieren (z.B. Computerspiele zu spielen), werden sie zu aktiven Gestaltern. Dieser Perspektivwechsel – vom Benutzer zum Macher – schult einen bewussteren und kritischeren Umgang mit Medien insgesamt.
- Kritisches Denken: Wenn ein Robotik-Projekt nicht wie erwartet funktioniert, müssen Kinder analysieren, warum. Diese Fehlersuche fördert das kritische Hinterfragen von Lösungswegen. Sie lernen, nicht sofort die erstbeste Idee als gegeben hinzunehmen, sondern Alternativen abzuwägen („Hat mein Programm wirklich das gemacht, was ich wollte, oder muss ich etwas ändern?“). So entwickeln sie die Fähigkeit, komplexe Situationen zu durchdenken und aus Fehlern zu lernen.
- Durchhaltevermögen und Selbstvertrauen: Ein Programm zum Laufen zu bringen erfordert manchmal mehrere Anläufe. Kinder üben mit Codey Rocky, Geduld und Ausdauer zu haben, bis das Ziel erreicht ist. Das Erfolgserlebnis, wenn der Roboter endlich macht, was er soll, stärkt dann enorm das Selbstvertrauen. Die Kinder sehen: „Ich kann etwas Schwieriges schaffen, wenn ich dranbleibe.“ Diese Erfahrung motiviert sie, auch zukünftige Herausforderungen optimistisch anzugehen.
- Teamarbeit und Kommunikation: Obwohl ein Kind den Roboter auch allein nutzen kann, bietet sich oft die Gelegenheit zur Zusammenarbeit – sei es mit Geschwistern, Freunden oder auch den Eltern. Beim gemeinsamen Tüfteln lernen Kinder, Ideen auszutauschen, Arbeitsschritte abzustimmen und einander zu helfen. Sie erklären vielleicht den Großeltern stolz, was sie programmiert haben, oder lösen mit einem Freund zusammen eine knifflige Aufgabe. Solche sozialen Interaktionen fördern Kommunikationsfähigkeiten und Teamgeist.
Insgesamt führt der spielerische Umgang mit Codey Rocky dazu, dass Kinder wichtige MINT-Kompetenzen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) erwerben, ohne dass es sich nach trockenem Lernen anfühlt. Diese grundlegenden Fähigkeiten – vom logischen Denken bis zur Kreativität – bilden eine hervorragende Basis, von der die Kinder in der Schule und späteren Ausbildung profitieren können.


Integration in den Alltag – Eltern als Begleiter
Wie können Eltern ihr Kind unterstützen, damit Codey Rocky optimal genutzt wird? Die gute Nachricht: Man muss selbst kein Technikexperte sein, um gemeinsam Spaß beim Programmieren zu haben. Hier ein paar Tipps, wie der Roboter sinnvoll in den Familienalltag eingebunden werden kann und Eltern zu motivierten Begleitern werden:
- Gemeinsam entdecken: Gerade am Anfang lohnt es sich, wenn Eltern und Kind Codey Rocky zusammen erkunden. Schaut euch ruhig gemeinsam die ersten Schritte in der App oder Anleitung an. Das zeigt dem Kind, dass auch Mama oder Papa etwas dazulernt – und nimmt den Druck, sofort alles richtig machen zu müssen. Außerdem macht es Kindern oft Freude, den Eltern etwas zu erklären, sobald sie selbst etwas herausgefunden haben.
- Interesse zeigen: Fragt euer Kind regelmäßig, was es Neues mit dem Roboter gemacht hat. Lasst es in eigenen Worten erklären, wie sein Programm funktioniert. Dieses Erzählen festigt nicht nur das Wissen des Kindes, sondern zeigt ihm auch: Meine Eltern finden es toll, was ich da mache. Ein ehrlich interessiertes Publikum für die selbstgeschriebenen Programme ist für Kinder eine riesige Motivation.
- Ohne Vorwissen startklar: Scheut euch nicht, mit eurem Kind zusammen einzusteigen, auch wenn Programmieren für euch Neuland ist. Viele Apps (auch die Makeblock-App) bieten Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tutorials, die man gemeinsam durchgehen kann. So lernt ihr quasi als Team. Euer Kind wird stolz sein, wenn es euch etwas vormachen kann, und ihr behaltet den Überblick, falls Hilfe nötig ist.
- Fehler zulassen und begleiten: Wenn beim Programmieren etwas schiefgeht, ist das kein Grund zur Sorge, sondern gehört dazu. Wichtig ist, Fehlertoleranz vorzuleben. Statt sofort einzugreifen, könnt ihr euer Kind ermutigen: „Probier doch mal einen anderen Weg“ oder „Woran könnte es liegen, dass es noch nicht klappt?“. Überlegt gemeinsam, an welcher Stelle man im Programm etwas ändern kann. So lernt das Kind, dass Fehler kein Scheitern sind, sondern Teil des Lernprozesses – und es erfährt, dass ihr hinter ihm steht, auch wenn etwas nicht gleich funktioniert.
- Alltagstaugliche Projekte auswählen: Verbindet den Roboter mit alltäglichen Spielen. Zum Beispiel könnt ihr zusammen einen kleinen Hindernisparcours aus Büchern oder Bauklötzen bauen und euer Kind herausfordern: „Schaffst du es, dass Codey Rocky da durchfährt, ohne etwas umzustoßen?“ Solche konkreten Aufgaben aus dem echten Leben machen das Programmieren greifbar. Oder nutzt Codey Rocky als Helfer – lasst ihn z.B. einen Timer stellen, der piept, wenn die Hausaufgabenzeit um ist. Je mehr Bezug zur Lebenswelt des Kindes, desto spannender wird es.
- Zeit und Raum geben: Richtet feste „Robotik-Zeiten“ oder einen kleinen Technikplatz ein, an dem Codey Rocky ausprobiert werden kann. Wenn das Kind vertieft am Programmieren ist, versucht es nicht zu sehr zu unterbrechen – in diesen Momenten ist Konzentration gefragt. Gleichzeitig sollte das Ganze nicht in Stress ausarten: Kurze, regelmäßige Sessions (z.B. jeden zweiten Tag 30 Minuten) können besser sein als seltene Marathon-Sitzungen. Findet einen Rhythmus, der zu eurem Familienalltag passt.
- Zusammen feiern: Wenn ein Projekt gelungen ist – egal wie klein es scheint – feiert es gemeinsam! Vielleicht führt euer Kind der ganzen Familie vor, was der Roboter jetzt kann, oder ihr nehmt ein kleines Video davon auf. Diese Wertschätzung steigert die Freude am Lernen ungemein. Zeigt Begeisterung für die Fortschritte und habt Geduld, wenn euer Kind stolz jedes Detail erklären möchte. So entsteht ein positives Lernumfeld, in dem euer Nachwuchs gerne weiter experimentiert.
Durch solche begleitenden Maßnahmen wird Codey Rocky nicht nur ein Spielzeug, mit dem das Kind allein im Zimmer verschwindet, sondern ein Erlebnis, das die Familie teilen kann. Selbst technikferne Eltern können staunen, wie schnell ihre Kinder ihnen vielleicht etwas über Sensoren und Schleifen beibringen – und genau das ist doch ein wunderbarer Rollenwechsel, wenn Kinder zu kleinen Lehrern werden!
Programmierumgebungen: Makeblock-App, Scratch und Python
Damit das Programmieren mit Codey Rocky gelingt, braucht es die passende Software. Makeblock stellt den Nutzern gleich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die je nach Alter und Vorkenntnis genutzt werden können. Im Zentrum steht dabei eine visuelle Programmierumgebung, die auf Scratch basiert – einer bekannten kindgerechten Programmiersprache.
Makeblock-App (für Smartphone/Tablet): Für einen schnellen Start gibt es die offizielle Makeblock-App auf iOS und Android. Diese App bietet verschiedene Modi, die den Zugang zum Roboter sehr niedrigschwellig gestalten:
- Es gibt einen Steuerungsmodus („Drive“), in dem das Tablet/Smartphone wie eine Fernbedienung funktioniert – per virtuellem Joystick oder durch Neigen des Geräts kann das Kind Codey Rocky direkt fahren lassen. So kann man erstmal spielerisch erkunden, wie sich der Roboter bewegt.
- Dann bietet die App den Modus „Zeichnen & Abfahren“ („Draw and Run“): Hier kann das Kind mit dem Finger eine Linie oder eine Form auf dem Bildschirm zeichnen, und Codey Rocky wird versuchen, dieser gezeichneten Route zu folgen. Alternativ kann man Muster malen, die dann auf dem LED-Display des Roboters erscheinen. Das ist intuitiv und kommt ganz ohne Textbefehle aus – ideal für die jüngsten Nutzer.
- Natürlich beinhaltet die App auch einen Coding-Modus: Das ist eine mobile Version der Blockprogrammierung, ähnlich wie bei Scratch. In einem einfachen Editor kann man aus Kategorien (Bewegung, Anzeige, Steuerung, Sensoren etc.) passende Bausteine auswählen und eigene Programme zusammenstellen. Die App stellt sicher, dass Codey Rocky live verbunden ist, sodass man Programme direkt ausführen und ausprobieren kann.
mBlock 5 Software (für PC und Tablet): Für umfangreichere Programmierung stellt Makeblock die Software mBlock 5 bereit, die sowohl als Download für Windows/Mac verfügbar ist als auch in einer Web-Version im Browser läuft. mBlock 5 basiert auf Scratch 3.0 und erweitert dieses um spezielle Blöcke für Makeblock-Roboter und zusätzliche Features. In der mBlock-Oberfläche arbeiten Kinder mit derselben Blocklogik wie in der App, jedoch mit noch mehr Möglichkeiten. Links gibt es eine Blockpalette (z.B. Bewegung, LED-Anzeige, Kontrolle, Sensoren), in der Mitte das Programmierfeld zum Zusammenstecken der Blöcke, und rechts kann man den verbundenen Roboter steuern oder Daten einsehen. Ein großer Vorteil dieser Software ist, dass sie strukturierte Lektionen und Beispiele bietet. Makeblock hat zahlreiche Lernmaterialien integriert – vom Anfänger-Tutorial („Lass Codey Rocky ein Gesicht anzeigen“) bis hin zu komplexeren Projekten. Kinder können diese Lektionen Schritt für Schritt durchgehen und dabei Erfolge sammeln, was den Lerneffekt spielerisch unterstützt.
Ein Highlight für fortgeschrittene Nutzer: In mBlock kann man jederzeit mit einem Klick den Python-Code einblenden, der hinter den Blockprogrammen steckt. So bekommen Kinder, die neugierig sind, wie ein „richtiges“ Programm aussieht, direkten Einblick in die textbasierte Version ihres Block-Programms. Python ist als Programmiersprache relativ einsteigerfreundlich und wird auch in weiterführenden Schulen unterrichtet. Codey Rocky ermöglicht es, ab einem bestimmten Lernstand auch direkt in Python zu programmieren. Das heißt, wer möchte (und vielleicht schon etwas älter ist), kann die Blöcke zur Seite legen und Befehle direkt schreiben. Diese Option sorgt dafür, dass Codey Rocky auch über die Grundschule hinaus relevant bleibt – man kann mit dem Roboter quasi mitwachsen und immer anspruchsvollere Projekte umsetzen.
Für den Alltag mit Grundschulkindern bleibt jedoch die Blockprogrammierung der Kern. Scratch bzw. mBlock bietet den großen Vorteil, dass es kaum frustrierende Erlebnisse durch Tippfehler oder strenge Syntax gibt. Die Kinder konzentrieren sich auf die Logik ihres Programms, während die Software die korrekte Schreibweise im Hintergrund gewährleistet. Zudem ist Scratch weltweit verbreitet; viele Schulen setzen es im Informatikunterricht ein. Was ein Kind also zu Hause mit Codey Rocky lernt – zum Beispiel eine Schleife zu bauen oder eine Bedingung einzusetzen – wird ihm später im Schulunterricht wiederbegegnen. Insofern schafft die Makeblock-Umgebung eine Verbindung zwischen dem heimischen Spiel und der schulischen Bildung.
Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass die Apps und Software regelmäßig aktualisiert werden und neue Funktionen erhalten. So hat Makeblock in mBlock auch fortschrittliche Themen wie KI (künstliche Intelligenz) integriert (z.B. Bilderkennung via Webcam, Spracherkennung), die in Kombination mit Codey Rocky erkundet werden können. Zwar sprengt das den Rahmen eines Grundschulkindes, aber es zeigt, welche Bandbreite an Lerninhalten theoretisch zur Verfügung steht. Für den Anfang reicht es vollkommen, mit den grundlegenden Blöcken zu spielen – der Rest kann warten, bis das Interesse von selbst kommt.


Programmierbeispiele für Grundschulkinder
Am besten lässt sich das Potenzial von Codey Rocky verstehen, indem man ein paar konkrete Beispiele betrachtet, was Grundschulkinder damit programmieren können. Hier sind einige typische Projekte, die sowohl einfach genug als Einstieg sind als auch für leuchtende Kinderaugen sorgen:
- Linienfolger: Ein klassisches Einsteigerprojekt ist, Codey Rocky einer Linie folgen zu lassen. Dazu zeichnet man etwa mit schwarzem Filzstift eine Strecke auf weißes Papier oder legt ein schwarzes Band am Boden aus. Der Roboter wird so programmiert, dass sein Unterseiten-Sensor die dunkle Linie erkennt und automatisch darauf bleibt – er korrigiert seine Richtung, sobald er die Linie zu verlieren droht. Die Kinder sind fasziniert, wie der Roboter scheinbar von selbst den Weg findet. Dieses Projekt verdeutlicht den Einsatz des Farbsensors und einfacher Logik (Schleifen und Entscheidungen: „wenn rechts von der Linie, dann nach links lenken…“).
- Reaktion auf Licht und Geräusch: Hier lernen Kinder, die Umweltsensoren einzusetzen. Ein Beispielprogramm könnte so aussehen: „Wenn es dunkel wird, dann schalte die LED-Lampe ein und zeige ein schlafendes Gesicht; wenn es wieder hell wird, spiele einen fröhlichen Ton.“ Kombiniert mit dem Geräuschsensor könnte Codey Rocky z.B. auf laute Geräusche reagieren – man klatscht in die Hände und der Roboter antwortet mit einem Sound oder einem bunten Blinken. Solche Spielereien machen nicht nur Spaß, sondern zeigen dem Kind unmittelbar, wie Sensorwerte im Programm Entscheidungen beeinflussen können.
- Emotions-Anzeige per Tastendruck: Mit dem LED-Display lassen sich prima Emotionen oder Stimmungen darstellen. Kinder programmieren gern kleine „Sketche“, in denen Codey Rocky fast wie ein Schauspieler reagiert. Zum Beispiel: Bei Druck auf Taste A lacht Codey (lachendes Gesicht + Lachen-Sound), bei Druck auf Taste B staunt er (große Augen auf dem Display) und bei Druck auf Taste C wird er „müde“ (verschlafene Augen und Gähn-Geräusch). Dieses Projekt verbindet Eingaben (Tasten) mit Ausgaben (Display/Sound) und fördert das Verständnis von Ereignissteuerung.
- Hindernis-Vermeidung: Hier wird Codey Rocky zum autonomen Fahrzeug. Das Kind programmiert eine Dauerschleife: „Fahre vorwärts, bis der Abstandssensor ein Hindernis erkennt, dann bleibe stehen und gib einen Warnton aus.“ Alternativ kann man den Roboter auch ausweichen lassen: „Wenn Hindernis vorne, dann stoppe und drehe nach links, dann fahre weiter.“ Mit ein paar Blöcken wird aus dem Roboter ein kleines selbstfahrendes Auto, das Wänden ausweicht. Die Kinder können damit herumexperimentieren, z.B. unterschiedliche Abstände einstellen oder den Roboter in ein Labyrinth schicken und beobachten, wie er reagiert.
- Farbsensor-Spiel: Nutzt man die Farberkennung, kann man ein buntes Spiel gestalten. Beispiel: Man legt rote, grüne und blaue Karten aus. Codey Rocky fährt herum und „sieht“ mit seinem Sensor die Farben. Je nachdem, welche Farbe er erkennt, führt er eine Aktion aus – bei Rot bleibt er erschrocken stehen (als wäre es ein Stoppschild), bei Grün spielt er einen fröhlichen Ton und fährt schneller, bei Blau dreht er sich im Kreis. Dieses Spiel lässt sich beliebig variieren (auch mit anderen Farben oder Musterkombinationen) und fördert die Experimentierfreude, weil die Kinder selbst festlegen können, welche Reaktion auf welche Farbe erfolgen soll.
- Tanz und Musik: Für kreativ-musikalische Kids kann man Codey Rocky auch eine Abfolge von Tanzbewegungen und Tönen beibringen. Zum Beispiel erstellt das Kind eine kleine Choreografie: vorwärtsfahren, rückwärtsfahren, dabei das LED-Display in wechselnden Farben blinken lassen und eine Melodie abspielen. Das Ergebnis ist eine Art Mini-Roboter-Disco, die man auf einer kleinen „Bühne“ vorführen kann. Hier kommen Schleifen für Wiederholungen und genaue Zeitsteuerungen zum Einsatz – eine schöne Übung in Rhythmusgefühl und Planung.
Dies sind nur einige Ideen – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Wichtig ist, dass die Beispiele an das Alter und Interesse des Kindes angepasst sind. Ein jüngeres Kind ist vielleicht schon stolz, wenn der Roboter auf Befehl losrollt oder ein Herzsymbol zeigt. Ältere Kinder wollen eventuell kniffligere Aufgaben lösen oder eigene kleine Anwendungen erfinden. Codey Rocky bietet in jedem Fall den Spielraum, vom simplen Experiment bis zum ausgefeilten Projekt alles umzusetzen. Und die leuchtenden Augen, wenn der Roboter genau das tut, was man ihm gerade beigebracht hat, sprechen Bände über den Lernerfolg.

Lerninhalte und didaktischer Aufbau
Die Lernkurve beim Programmieren mit Codey Rocky verläuft angenehm sanft und dennoch kontinuierlich aufwärts. Für gewöhnlich beginnt ein Kind mit einfachen Experimenten und steigert nach und nach die Komplexität seiner Projekte, ohne dass es einer strengen Unterrichtsstruktur folgen müsste. Dennoch lässt sich ein gewisser didaktischer Aufbau erkennen, der von Makeblock auch durch Materialien unterstützt wird.
Einstieg und Grundlagen: Zu Beginn steht das Kennenlernen der Hardware und der grundlegenden Programmierkonzepte. Oft startet man damit, Codey Rocky manuell zu steuern oder ganz einfache Programme aus vorgefertigten Beispielen auszuführen. Die Makeblock-App und mBlock-Software liefern hierfür kleine Tutorials: Zum Beispiel lernt das Kind in Lektion 1 vielleicht, wie man Codey Rockies Gesicht ändert, in Lektion 2, wie man ihn vorwärts fahren lässt, etc. In dieser Phase werden ganz nebenbei wichtige Prinzipien wie Sequenz (eine Reihe von Befehlen hintereinander) und Ereignisse (etwa „beim Start“ oder „bei Tastendruck“) eingeführt. Die Erfolgserlebnisse stellen sich schnell ein – der Roboter macht etwas und das Kind versteht: „Das habe ich ihm gesagt zu tun.“
Ausbau und Vertiefung: Nachdem die Basis klar ist, folgt die Phase, in der Kinder beginnen, eigenständig zu kombinieren. Jetzt werden die ersten Schleifen und Bedingungen interessant. Vielleicht möchte das Kind, dass Codey Rocky ein Licht so lange blinken lässt, bis man eine Taste drückt – schon braucht es eine Wiederholungsschleife und eine Wenn-Bedingung mit Abfrage der Taste. Solche Konstrukte werden meist in spielerischen Mini-Projekten eingeführt (z.B. ein Reaktionsspiel: „Drücke den Knopf, sobald das Gesicht erscheint“). In dieser Phase lernen die Kinder, etwas planvoller vorzugehen: Sie überlegen sich, was passieren soll, und setzen es dann in Blöcke um. Das ist ein großer kognitiver Schritt vom rein experimentellen Ausprobieren hin zum algorithmischen Planen.
Fortgeschrittene Projekte: Hat ein Kind erst einmal mehrere kleine Programme gebaut, wächst der Appetit auf mehr. Jetzt kommen eventuell komplexere Vorhaben in den Blick: ein kleines Spiel entwickeln, eine längere Reaktionskette programmieren oder mehrere Sensoren kombinieren. Hier bietet Codey Rocky genug Stoff, um auch über Jahre hinweg immer neue Lerninhalte zu erschließen. Ein 10-jähriges Kind könnte zum Beispiel versuchen, den Roboter per Geräuschsensor auf Klatsch-Kommandos reagieren zu lassen und gleichzeitig per Display Punkte zu zählen – das verlangt schon das Zusammenspiel mehrerer Funktionen und vielleicht den Einsatz einer Variablen, um den Punktestand zu speichern. Die didaktischen Unterlagen von Makeblock (viele sind online abrufbar) liefern Inspirationen und manchmal richtige Unterrichtspläne, wie man von einer Stufe zur nächsten gelangt. Dabei werden keine harten Grenzen gesetzt: Jedes Kind kann im eigenen Tempo tiefer eintauchen. Wichtig ist, dass die Motivation erhalten bleibt. Hier glänzt Codey Rocky dadurch, dass fortgeschrittene Themen wie KI und IoT zwar optional, aber vorhanden sind – das heißt, sollte ein Kind außergewöhnlich interessiert sein, kann man ihm z.B. zeigen, wie Codey Rocky Wetterdaten holt oder mit einer einfachen KI-Bilderkennung verknüpft wird. Solche Inhalte sind zwar nicht die Regel im Grundschulalter, können aber talentierte junge Programmierer zusätzlich kitzeln.
Lernpfad und Progression: In vielen Fällen sieht der Lernweg so aus: Anfangs werden einzelne Befehle ausprobiert (Bewegung, Licht, Sound). Dann merkt das Kind, dass es diese kombinieren kann („gleichzeitig fahren und Musik spielen“). Anschließend kommt Logik ins Spiel: Bedingungen, damit der Roboter z.B. nur manchmal etwas tut. Schließlich fängt das Kind an, eigene Ideen umzusetzen statt nur Vorgaben – es denkt sich ein Ziel aus und versucht, es zu erreichen. Dieser Übergang vom Nachbauen zum eigenen Gestalten ist didaktisch gesehen der wichtigste Schritt, weil er zeigt, dass das Kind das Gelernte auf neue Situationen anwenden kann. Codey Rocky unterstützt diesen Prozess durch seine Vielseitigkeit – es gibt immer noch einen Sensor oder Effekt, den man hinzufügen könnte, um ein Projekt zu erweitern. Dadurch wird es nie langweilig, und das Kind hat stets die Möglichkeit, noch einen Schritt weiterzugehen.
Zusammengefasst ermöglicht Codey Rocky einen didaktisch sinnvollen Lernprozess vom Einfachen zum Komplexen, ohne die jungen Programmierer zu überfordern. Jedes Kind kann nach seinen Möglichkeiten voranschreiten. Ob es bei ein paar grundlegenden Konzepten bleibt oder ob es am Ende mit Variablen, Schleifen und vielleicht ersten Python-Ausflügen experimentiert – in beiden Fällen hat es etwas Wertvolles gelernt. Diese Flexibilität macht Codey Rocky auch für den Einsatz in Schulen attraktiv, wo unterschiedliche Leistungsniveaus berücksichtigt werden müssen. Für zuhause bedeutet es: Der Roboter wird nicht so schnell „ausgelernt“. Selbst nach Monaten kann man noch Aha-Momente erleben, wenn man eine neue Funktion entdeckt oder eine Idee endlich funktioniert.

Motivation und Interaktion: Erfahrungswerte aus der Praxis
Ein entscheidender Faktor für jedes Lernspielzeug ist die Begeisterung der Kinder: Bleiben sie dran? Haben sie langfristig Freude daran? Bei Codey Rocky sind die Erfahrungen hier überwiegend positiv. Die Motivation der Kinder wird vor allem dadurch hochgehalten, dass sie sichtbare Ergebnisse ihrer Programmierung bekommen. Wenn der Roboter auf ein selbst geschriebenes Kommando hin losrollt oder ein lustiges Gesicht macht, ist die Freude (und auch ein bisschen Stolz) sofort da. Dieses unmittelbare Feedback ist sehr viel greifbarer als z.B. ein Ergebnis auf dem Computerbildschirm – es bewegt sich ja wirklich etwas im Raum, das man selbst verursacht hat.
Viele Eltern berichten, dass ihre Kinder den Codey Rocky gar nicht mehr aus der Hand legen wollen, sobald er einmal eingerichtet ist. Besonders in den ersten Wochen nach der Anschaffung wird oft täglich damit gespielt und programmiert. Hier zeigt sich ein Vorteil des Konzepts: Es fühlt sich für die Kinder wie Spielen an, nicht wie Lernen. Sie probieren Dinge aus, lachen, wenn der Roboter etwas Unerwartetes tut, und wollen es dann besser machen oder verändern. Durch diese spielerische Herangehensweise bleibt die Motivation hoch – ähnlich wie bei einem Videospiel, nur mit dem Unterschied, dass hier konstruktiv etwas geschaffen wird.
Natürlich gibt es Unterschiede je nach Kind. Jüngere Grundschüler (etwa 6–7 Jahre) benötigen manchmal noch Unterstützung, um die Aufmerksamkeit zu halten. Für sie sind kurze, abwechslungsreiche Einheiten am besten – zum Beispiel jeden Tag ein kleines „Projektchen“. Eltern können helfen, indem sie kleine Aufgaben stellen („Kannst du ihn so programmieren, dass er genau bis zum Tisch fährt?“) oder gemeinsam Geschichten ausdenken, die der Roboter nachspielen soll. Ältere Kinder (9–10 Jahre) gehen oft schon selbstständiger an längere Projekte heran. Sie können sich mit Codey Rocky auch mal eine Stunde oder länger beschäftigen, vor allem wenn sie ein konkretes Ziel vor Augen haben (z.B. eine Mini-Show vorbereiten, die sie vorführen möchten).
Wo Unterstützung nötig ist, wurde teilweise schon im Abschnitt Eltern als Begleiter angesprochen. Insbesondere wenn Frustration aufkommt – etwa weil ein Programm nicht sofort klappt – ist die Reaktion der Erwachsenen wichtig. Geduld und Ermunterung zahlen sich hier aus. Kinder sollten die Erfahrung machen, dass es normal ist, Fehler zu machen, und dass man mit Ruhe und Ausprobieren weiterkommt. Die meisten Kinder zeigen dabei erstaunlich viel Ehrgeiz, wenn sie die richtige Balance aus Herausforderung und Machbarkeit finden. Codey Rocky liefert viele Erfolgserlebnisse, aber eben auch immer wieder neue kleine Rätsel, die gelöst werden wollen. Diese Mischung hält die Motivation lebendig.
Ein interessanter Aspekt ist auch die Interaktion des Kindes mit dem Spielzeug auf einer emotionalen Ebene. Viele Kinder fangen an, Codey Rocky wie ein kleines Wesen zu behandeln – sie geben ihm einen Namen, sprechen mit ihm, lachen ihn an, schimpfen spielerisch, wenn er mal nicht tut, was er soll, und freuen sich über seine Gesichtsausdrücke. Diese emotionale Bindung mag aus Sicht eines Erwachsenen niedlich erscheinen, hat aber einen starken pädagogischen Effekt: Das Kind will sich weiter mit dem Roboter beschäftigen, weil es das Gefühl hat, mit einem Freund zu interagieren und nicht mit einer Maschine. So bleibt das Interesse oft über längere Zeit bestehen, als wenn es nur ein mechanisches Fahrzeug ohne Persönlichkeit wäre.
Im Familienalltag zeigt sich Codey Rocky oft als Mittel, um Generationen zu verbinden. Kinder führen stolz ihre Kreationen vor, Eltern oder Großeltern staunen, was der kleine Kerl alles kann. Einige Eltern erzählen, dass auch sie selbst Spaß daran gefunden haben, mit dem Roboter zu experimentieren – teils auf Anregung der Kinder hin („Komm Papa, ich zeig dir, wie das geht!“). So wird das Lernen gemeinschaftlich. Und wenn mal Besuch da ist – seien es Freunde des Kindes oder Verwandte – avanciert Codey Rocky nicht selten zum Highlight, das vorgeführt werden muss. Dieses soziale Teilen der Erfahrungen verstärkt die Motivation, immer wieder etwas Neues mit Codey Rocky auszuprobieren, damit man es anderen zeigen kann.
Wie lange die Begeisterung anhält, hängt natürlich auch davon ab, wie sehr man sie füttert. Bleibt es monatelang bei immer demselben Trick, könnte es irgendwann langweilig werden. Doch hier können Eltern leicht entgegenwirken, indem sie Inspiration bieten (wie in Abschnitt 7 mit den Beispielen). Die Möglichkeiten sind so vielfältig, dass eigentlich immer wieder frische Ideen gefunden werden können. Vielleicht organisiert man sogar mal ein kleines Coding-Treffen mit einem befreundeten Kind, das einen ähnlichen Roboter hat – gemeinsam programmieren macht vielen Kindern noch mehr Spaß und bringt neue Ideen hervor.
Zusammenfassend lässt sich aus der Praxis sagen: Codey Rocky hat ein gutes Durchhaltevermögen in Sachen Interesse. Gerade weil er ein aktives Spielzeug ist – eines, mit dem man kreativ sein muss, nicht nur Knöpfchen drücken – fordert und fördert er Kinder über längere Zeit. Und selbst wenn er mal eine Weile unbeachtet im Regal steht, reicht oft ein kleiner Anstoß (eine neue Projektidee, ein Update mit zusätzlichen Funktionen), um die Faszination wieder zu entfachen.
Wartung, Erweiterbarkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis
Zum Schluss soll noch beleuchtet werden, was Eltern in Bezug auf Wartung, Erweiterbarkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis von Codey Rocky wissen sollten.
Wartung und Haltbarkeit: Codey Rocky ist erfreulich pflegeleicht. Der Roboter hat einen fest verbauten Lithium-Polymer-Akku, der über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen wird. Eine volle Ladung benötigt ungefähr 1,5 Stunden und reicht je nach Nutzung für etwa 1–2 Stunden aktiven Spiel- und Programmierbetrieb. Für den Hausgebrauch bedeutet das: In der Regel hält der Akku problemlos mehrere Sessions, da Kinder selten zwei Stunden am Stück durchgehend fahren lassen. Es schadet aber nicht, den Roboter nach dem Spielen wieder ans Ladegerät zu hängen, damit er beim nächsten Mal direkt einsatzbereit ist. Wer das Gerät längere Zeit nicht benutzt, sollte den Akku hin und wieder nachladen (alle paar Monate), um die Lebensdauer zu erhalten – wie bei jedem akkubetriebenen Spielzeug.
Ansonsten fällt kaum Wartungsaufwand an. Es gibt keine filigranen Bauteile, die regelmäßig justiert werden müssten. Ab und zu kann man mit einem weichen Tuch über die Sensoren wischen, falls sich Staub abgesetzt hat, und prüfen, ob sich keine Fussel in den Antriebsrädern verfangen haben (gerade wenn Codey Rocky über den Teppich flitzt, könnten sich Haare in den Achsen sammeln – das ist aber leicht mit den Fingern zu entfernen). Wichtig ist natürlich, den Roboter vor Nässe zu schützen – elektronische Komponenten und Wasser vertragen sich nicht. Einmal vom Getränk überschwemmt, könnte es Probleme geben. Aber im normalen Indoor-Einsatz ist er robust genug, auch mal aus geringer Höhe vom Tisch zu fallen, ohne gleich kaputt zu gehen. Sollte tatsächlich mal etwas defekt sein, bietet Makeblock Ersatzteile und Support an. In der Regel ist Codey Rocky jedoch so gebaut, dass er jahrelang im Kinderzimmer seinen Dienst tun kann.
Erweiterbarkeit und Zubehör: Wie schon bei der Hardware beschrieben, lässt sich Codey Rocky mit LEGO baulich erweitern. Das ist ein großer Pluspunkt, denn Kinder entwickeln oft den Wunsch, ihren Roboter zu individualisieren – sei es aus ästhetischen Gründen oder um neue Funktionen auszuprobieren. Mit ein paar Technic-Elementen kann man z.B. einen Greifarm improvisieren oder den Roboter in ein „Fahrzeug“ mit Karosserie verwandeln. Solche Bastelideen halten das Spielzeug interessant und eröffnen zusätzliche Lerneffekte (Mechanik, Konstruktion, Design). Darüber hinaus gibt es im Makeblock-Universum weiteres Zubehör: Besonders erwähnenswert ist der Makeblock Neuron-Kasten. Das ist ein Elektronik-Baukastensystem mit magnetisch verbindbaren Modulen – Sensoren, Lichter, Motoren, sogar ein Kamera-Modul. Codey Rocky kann mit Neuron-Modulen kombiniert werden; er hat an der Seite einen Anschluss, über den er mit Neuron-Blöcken kommunizieren kann. Theoretisch kann man so den Roboter um noch mehr Komponenten erweitern (z.B. zusätzliche Sensoren oder Ausgabegeräte) und noch komplexere Projekte realisieren. In der Praxis nutzen das vor allem Schulen oder sehr ambitionierte Tüftler, aber es ist gut zu wissen, dass Codey Rocky keine Sackgasse ist: Wenn das Kind in ein paar Jahren höhere Ansprüche hat, muss man nicht gleich einen komplett neuen Roboter kaufen – man kann ihn auch aufrüsten.
Erweiterbarkeit zeigt sich auch auf der Softwareseite: Die mBlock-Software erlaubt es, verschiedene Geräte und sogar KI-Funktionen einzubinden. Sollte der Nachwuchs später z.B. einen anderen Makeblock-Roboter (wie den größeren mBot) nutzen oder einen Arduino programmieren wollen, bleibt die Umgebung vertraut. Codey Rocky kann also als Grundstein dienen, auf dem weitere Technikbegeisterung aufbaut.
Preis-Leistungs-Verhältnis: Preislich liegt Codey Rocky je nach Angebot etwa bei 100 bis 150 Euro (Einzelset, Stand 2025). Damit befindet er sich im mittleren Preissegment für programmierbares Spielzeug. Angesichts der hochwertigen Verarbeitung, der Vielzahl an Funktionen und der mitgelieferten Software/Lernmaterialien ist das Preis-Leistungs-Verhältnis als sehr fair zu beurteilen. Günstigere Einstiegs-Roboter bieten oft weniger Möglichkeiten oder erfordern zusätzliche Käufe von Erweiterungen, während deutlich teurere Systeme (wie große Robotik-Bausätze) eher für ältere Kinder konzipiert sind. Codey Rocky füllt hier eine Lücke: Er ist robust genug für jüngere Kinder, aber gleichzeitig vielseitig und leistungsfähig, sodass er über mehrere Jahre interessant bleibt. Zusätzliche laufende Kosten entstehen praktisch keine – die Apps sind kostenlos, Batterien müssen dank Akku nicht regelmäßig gekauft werden.
Betrachtet man die Langlebigkeit, kann Codey Rocky ein Kind gut durch mehrere Jahre begleiten. Ein Schulkind, das mit 6 oder 7 Jahren damit beginnt, wird mit 10 Jahren immer noch Neues damit anfangen können (dann vielleicht in Richtung Python-Programmierung oder ausgefeilte eigene Projekte). Sollte das Interesse zwischendurch mal nachlassen, kann der Roboter bedenkenlos im Schrank warten, bis die Neugier wiederkommt – es verschleißt ja kaum etwas. Insofern relativieren sich die Anschaffungskosten über die Nutzungsdauer. Zudem hat Codey Rocky einen gewissen Wiederverkaufswert, falls man ihn später doch nicht mehr benötigt, da er aufgrund seiner Beliebtheit und Robustheit durchaus gefragt ist.
Zusammengefasst stimmt bei Codey Rocky das Preis-Leistungs-Verhältnis: Man investiert in ein durchdachtes Bildungs-Spielzeug, das mit viel Liebe zum Detail entwickelt wurde und sowohl kurzfristig Freude bringt als auch langfristig Fähigkeiten fördert. Die Qualität der Hardware und Software rechtfertigt den Preis – vor allem wenn man bedenkt, dass hier ein komplettes Lernsystem geboten wird (inklusive Online-Ressourcen und Community). Viele Eltern berichten, dass sie die Anschaffung nicht bereut haben, weil ihr Kind damit deutlich mehr gelernt hat als mit manch anderem Spielzeug, das nach kurzer Zeit ungenutzt liegenblieb.
Fazit
Makeblock Codey Rocky zeigt eindrucksvoll, dass Lernen und Spielen Hand in Hand gehen können. Der niedliche Roboter begeistert Grundschulkinder durch seine Interaktivität und führt sie ganz nebenbei an wichtige Zukunftsthemen wie Programmierung und Robotik heran. Mit seiner robusten Hardware und der vielseitigen Software ermöglicht er es Kindern, kreativ zu werden, Probleme zu lösen und eigene Projekte umzusetzen – und all das mit jeder Menge Spaß. Eltern erleben dabei, wie ihre Kinder spielerisch dazulernen, und können als Partner und Mitlernende diesen Weg begleiten.
In einer Zeit, in der digitale Bildung immer wichtiger wird, bietet Codey Rocky einen spielerischen Zugang zu Technik und Programmierung. Durch die zahlreichen Möglichkeiten und die Erweiterbarkeit bleibt er lange interessant und wächst mit den Fähigkeiten des Kindes mit. Kurz gesagt: Codey Rocky ist mehr als ein Spielzeug – er ist ein kleiner Freund und Lehrer zugleich, der Kinder spielerisch fit für die digitale Zukunft macht.